Sting & Shaggy, 44/876, 2018
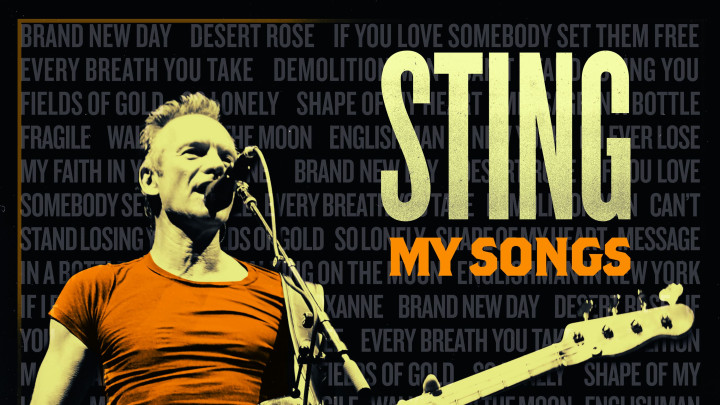
26.04.2018
Sting & Shaggy – „44/876“
Die ausgelassene, lockere Stimmung und der sommerliche Vibe von „44/876“, dem Gemeinschaftsalbum von Sting und Shaggy, basiert auf einer Gemeinsamkeit, die der Brite und der Jamaikaner schon zu Beginn ihrer Zusammenarbeit entdeckten – und die sie dann auch gleich zur Richtschnur für den kompletten Longplayer machten: Denn während der Albumtitel mit seinen Vorwahl-Ziffern auf die Heimatregionen beider Protagonisten verweist, ging es ihnen musikalisch vor allem um ihre geteilte Liebe zu Jamaika, zu Shaggys Heimat also und zugleich zu jenem Ort, an dem Sting einst u.a. zeitlose The Police-Hits wie „Every Breath You Take“ komponierte. Allerdings befassten sich Sting und Shaggy nicht nur intensiv mit Reggae und den für die Region typischen Beats, Stimmungen und Sounds, denn schon ein Vorbote wie „Don’t Make Me Wait“ zeigt zugleich, dass es noch eine Gemeinsamkeit gab: Ihre Songs müssen etwas Zeitloses haben. Ansteckend sein. Und dabei Erwartungen über den Haufen werfen.
Die erste Single „Don’t Make Me Wait“ entstand, nachdem Martin Kierszenbaum, der zuvor als A&R für Shaggy gearbeitet hatte und inzwischen Manager von Sting ist, die beiden persönlich miteinander bekannt gemacht hatte. Der ursprüngliche Plan bestand zwar einzig und allein darin, dass Sting in diesem Fall als Gastsänger und Co-Autor aushelfen sollte, doch stellten die beiden sehr schnell fest, wie gut, wie nahtlos ihre Stimmen miteinander harmonierten. Diese Chemie zwischen Sting und Shaggy war schließlich das Fundament, auf dem sie z.B. ein Liebeslied wie „Don’t Make Me Wait“ kreieren konnten – ein Song, dessen Wärme, dessen Groove und dessen grandiose Gitarren einen postwendend nach Jamaika transportieren…
Damit war der Startschuss auch schon gefallen: Für beide stand sofort fest, dass sie noch einen weiteren Track zusammen aufnehmen wollten, und dann noch einen… und so hatten sie schon bald annährend genug Material für ein ganzes Album zusammen. „Alles lief vollkommen organisch, nichts davon war irgendwie geplant“, sagt Shaggy über die Entstehung des Albums. Für die eigentlichen Aufnahmen, die in New York City stattfanden, holten sie etliche Schwergewichte von der US-Ostküste und aus Jamaika zu sich ins Studio: Legenden wie Robbie Shakespeare (von Sly & Robbie) waren genauso dabei wie der Dancehall-Star Aidonia, Morgan Heritage, DJ Agent Sasco, Branford Marsalis oder auch Stings angestammter Gitarrist Dominic Miller.
Zusammen mit ihrem Executive Producer Kierszenbaum und dem Produzenten Sting International (Shaun Pizzonia), der früher schon für internationale Shaggy-Hits wie „Oh Carolina“, „Boombastic“ oder auch „It Wasn’t Me“ verantwortlich war, gelingt es Sting und Shaggy auf „44/876“, die Energie der Karibik-Rhythmen mit zeitlosen Popmelodien und übergroßen Refrains zu vereinen. Inhaltlich knüpfen die beiden bei ihrem gemeinsamen Idol Bob Marley an und schreiben sich Liebe, Hoffnung, Freiheit und Einigkeit auf die Fahne: „Der rote Faden, der sich durch diese Songs zieht, besteht darin, dass es um eine Suche geht – um die Suche nach einer besseren Zukunft“, wie Sting es formuliert.
Reflektiert und optimistisch zugleich klingen z.B. „Waiting For The Break Of Day“, ein ruhigeres Klavierstück, und „Morning Is Coming“, bei dem sie auf lässigen Groove inklusive Bläsern setzen. Verspielter geben sich Sting & Shaggy auf „Just One Lifetime“, wenn sie zunächst ein paar gereimte Zeilen aus Lewis Carrolls „Alice hinter den Spiegeln“-Klassiker auftischen und danach Stings unverkennbare Stimme und Shaggys grandiosen Flow ineinander verschränken. Mit dem bewegenden „Dreaming In The USA“, das mit satten Beats daherkommt, blicken sie auf das Versprechen des „American life“, und was Nicht-Einheimische wie sie jeweils damit verbinden. „Das Beste an Amerika ist doch diese Offenheit, diese Willkommenskultur dem Rest der Welt gegenüber“, findet der Brite.
Sting, der nicht nur als Sänger weltbekannt ist, sondern auch zu den innovativsten Bassisten der Rockgeschichte zählt, ging seiner Liebe zum Reggae genau genommen schon als Mitglied von The Police nach. Auf die fünf Studioalben, die er in knapp 10 Jahren mit seiner ehemaligen Band aufnahm, was ihnen gleich sechs GRAMMYs und eine verspätete Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame im Jahr 2003 garantierte, folgte für den heute 66-Jährigen eine unvergleichliche Solokarriere: 10 weitere GRAMMYs, zwei BRITs, ein Golden Globe Award, einen Emmy, vier Oscar-Nominierungen, eine TONY-Nominierung, dazu den Century Award von Billboard und den Preis als „Person of the Year (2004)“ von MusiCares. Kombiniert man die Solo-Verkäufe mit den Absatzzahlen von The Police, hat er inzwischen knapp 100 Millionen Alben verkauft.
Der in Jamaika geborene und aufgewachsene Shaggy zog bereits als Jugendlicher in die USA: Er gab mit seinen Klassenkameraden in Flatbush, Brooklyn einfach nur ein paar Freestyles zum Besten, als ihm plötzlich klar wurde, dass er über ein ausgesprochenes Talent als Wortschmied und Sänger verfügte. Nach der Schullaufbahn ging er jedoch zunächst für ein paar Jahre zu den US-Marines, um 1993 dann mit einem Mal weltbekannt zu werden: Seine Hit-Single „Oh Carolina“ gilt seither als der erste Dancehall-Song, der es in England in die Charts geschafft hat (genauer: auf Platz 1 – zwei Wochen lang!). Maßgeblich dafür verantwortlich, dass Reggae und Dancehall plötzlich rund um den Globus viele, viele neue Fans fanden, gewann Shaggy 1996 für sein drittes Album „Boombastic“ sogar den Grammy für das „Best Reggae Album“ (und natürlich war der Titelsong noch so ein Welt-Hit, haufenweise Platin-Auszeichnungen inklusive). Weitere #1-Hits aus seinem Backkatalog sind z.B. „It Wasn’t Me“ oder auch „Angel“, die beide auf dem „Hot Shot“-Album vertreten waren – auch in Deutschland ein #1-Album und in den Staaten inzwischen bei einer Diamant-Auszeichnung angelangt. Heute lebt Shaggy mit seiner Frau und seinen Kindern übrigens wieder in seiner geliebten Heimat, in Jamaika…
Die Arbeit an „44/876“ empfanden beide gleichermaßen als inspirierend und herausfordernd: Besonders jene akribische Herangehensweise, mit der Sting seine Klangexperimente durchführt, sei für Shaggy eine echte Lektion gewesen, wie er rückblickend sagt; Sting hingegen war schwer angetan von der spontanen Energie, die Shaggy im Studio an den Tag legt – was sich auch direkt auf den Songwriting-Prozess ausgewirkt habe. „Das ganze Album basiert auf diesem genialen Konkurrenz-Ding, das wir am Laufen hatten: Jeder wollte dadurch immer noch ein bisschen mehr geben“, so Sting.
Da sie beide seit geraumer Zeit auch für ihre philanthropischen Aktivitäten bekannt sind – Sting gründete z.B. schon 1989 mit seiner Frau Trudie Styler den Rainforest Fund –, präsentierten Sting und Shaggy die erste Single „Don’t Make Me Wait“ erstmals im Rahmen einer großen Benefiz-Veranstaltung für das Bustamante-Kinderkrankenhaus in Kingston, Jamaika (Shaggy unterstützt diese Institution schon länger mit seiner eigenen Shaggy Make A Difference Foundation). Obwohl die 20.000 Menschen im Publikum den Song nie zuvor gehört hatten, sangen so gut wie alle auf Anhieb mit – was schon sehr viel aussagt über die ansteckende Energie, die ihre Kollaboration auszeichnet. „Einfach so mit Shaggy ins Studio zu gehen, ohne eine Ahnung davon, was dabei herauskommen würde, das war natürlich auch ein Sprung ins Ungewisse. Also ein gewisses Risiko war da schon dabei“, gibt Sting zu bedenken. „Aber es lohnt sich einfach, ein derartiges Risiko einzugehen, weil die besten kreativen Einfälle als Ausrutscher, als bloße Zufälle oder Unfälle anfangen… also muss man sich sagen: ‘Okay, ich verlasse jetzt mal meine Komfortzone und schau einfach, was dann so passiert.’ Und genau das haben wir bei diesem Album gemacht.“
Mehr von Sting